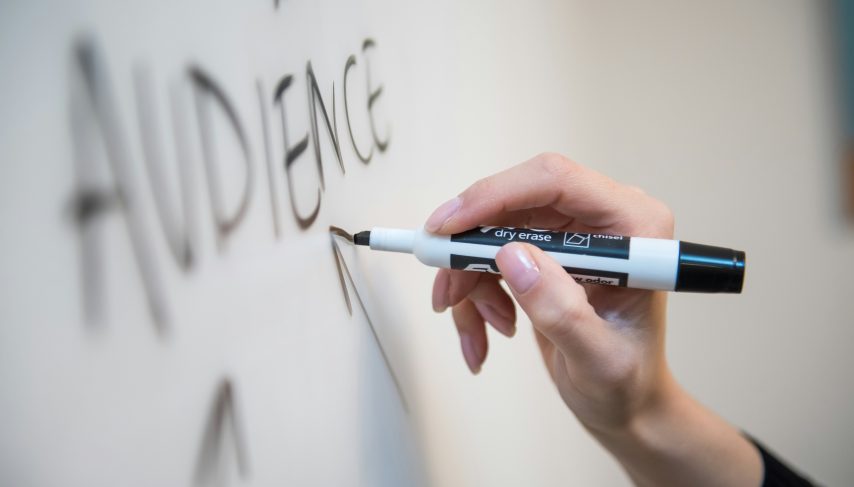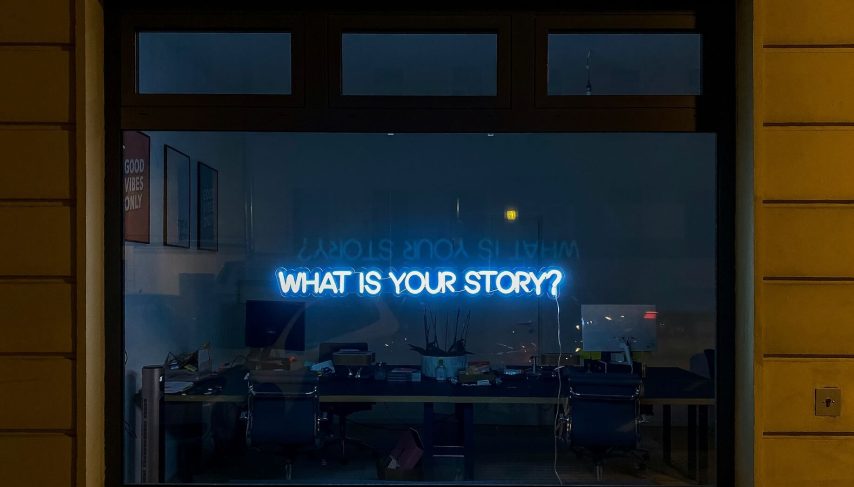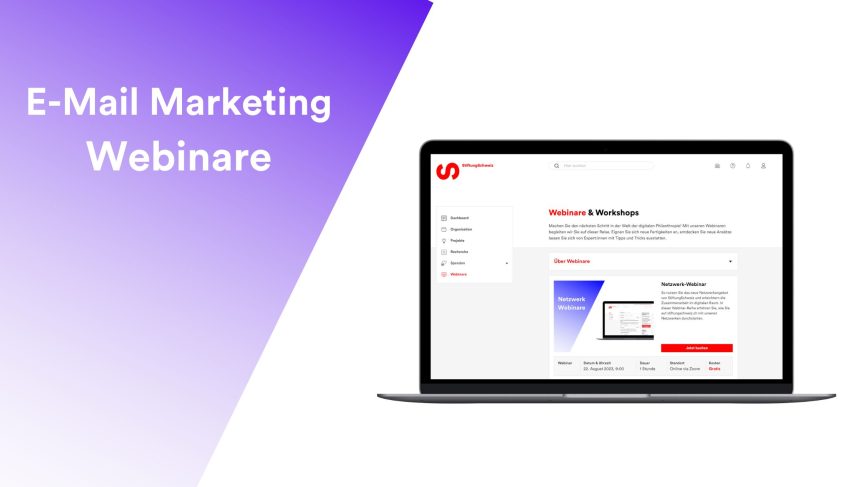Eine Stiftung gründen Sie in der Schweiz am besten durch realistische Ziele, ein durchdachtes Konzept und eine klare Planung. Mit diesen Tipps lässt sich eine erfolgreiche Stiftung aufbauen, die langfristig Gutes bewirkt.
Die Schweiz ist ein stiftungsfreundliches Land. Wer hier eine Stiftung gründen möchte, profitiert von vergleichsweise geringen Beschränkungen und einem flexiblen Rahmen. Das ist mitunter einer der Gründe, warum es in der Schweiz mit über 13’000 besonders viele Stiftungen gibt. Doch gerade weil die Gründung so einfach scheint, ist eine sorgfältige Vorbereitung entscheidend. Denn nachträgliche Anpassungen am Zweck oder an der Struktur einer Stiftung sind in der Regel mit erheblichem Aufwand verbunden oder gar nicht möglich.
Wer also eine eigene gemeinnützige Stiftung ins Leben rufen möchte, sollte sich umfassend informieren, die wichtigsten Entscheidungen wohlüberlegt treffen und auf eine solide rechtliche und finanzielle Grundlage achten.
Wie gründe ich eine gemeinnützige Stiftung in der Schweiz?
Die Gründung einer Stiftung beginnt lange vor dem eigentlichen Gründungsakt. Wer mit der Definition und Funktionsweise einer Stiftung bereits vertraut ist, kann sich mit der inhaltlichen und strategischen Planung auseinandersetzen. Das bedeutet unter anderem, den Stiftungszweck klar zu definieren, die Organisationsstruktur durchzudenken und die Finanzierung realistisch zu planen. Nur so können zukünftige Stifter:innen mit der Stiftung langfristig wirksam arbeiten – oder scheitern bereits bei der Anerkennung durch die Behörden.
Daher ist es hilfreich, zu Beginn einen Businessplan zu erstellen: Welches Anfangskapital ist realistisch? Welche einmaligen und laufenden Kosten entstehen? Welche Einnahmen oder Zustiftungen sind später möglich? Und wie können die Mittel effizient und zweckgerichtet eingesetzt werden?
Stiftungszweck: Wofür steht die Stiftung?
Zentraler Bestandteil jeder Stiftung ist ihr Zweck. Er bestimmt, was die Stiftung tun darf – und was nicht. Für gemeinnützige Stiftungen gilt zudem: Der Zweck muss im öffentlichen Interesse liegen. Die Formulierung dieses Zwecks erfordert Erfahrung und Sorgfalt, denn er lässt sich später nur unter strengen Voraussetzungen ändern. Daher empfiehlt es sich, gemeinsam mit spezialisierten Anwält:innen oder Berater:innen den Stiftungszweck zu definieren. Er soll klar, realisierbar und gleichzeitig flexibel genug sein, um auch in Zukunft relevant zu bleiben.
Im Gründungsdokument kann ausserdem ein sogenannter Zweckänderungsvorbehalt aufgenommen werden. Das ist eine Klausel, die unter bestimmten Bedingungen spätere Anpassungen erlaubt. Auch sinnvoll ist ein Leitbild oder ein Organisationsreglement, das dem Stiftungsrat Orientierung gibt und als strategische Grundlage dient.
Wichtig:
Der Stiftungszweck muss in einem sinnvollen Verhältnis zum vorhandenen oder geplanten Vermögen stehen. Wer beispielsweise mit wenig Kapital einen sehr breiten, ambitionierten Zweck verfolgt, läuft Gefahr, dass die Stiftung nicht anerkannt wird oder langfristig nicht handlungsfähig ist.
Stiftungskapital: Wie viel braucht es?
Das gesetzlich empfohlene Mindestkapital für eine Stiftung in der Schweiz liegt bei CHF 50’000. Dieses muss aber nicht nur in monetärer Form vorliegen. Auch Sachwerte wie Immobilien und Kunstobjekte oder Unternehmensanteile sind zulässig, müssen aber sorgfältig bewertet und in Bezug auf Liquidität und Zweckbindung geprüft werden. Das Stiftungskapital muss bei der Gründung grundsätzlich vollständig eingebracht sein. Spätere Zustiftungen sind möglich, aber nicht Teil des Gründungskapitals.
Tipp:
In der Praxis zeigt sich, dass das Minimum von CHF 50’000 kaum ausreicht, um eine Stiftung dauerhaft tragfähig zu führen. Erfahrungsgemäss braucht es ein Stiftungskapital von mindestens CHF 5 Millionen, damit eine Stiftung nachhaltig wirtschaften und regelmässige Ausschüttungen tätigen kann – ohne das Kapital selbst zu gefährden.
Kosten: Welche Ausgaben hat eine Stiftung?
Vor der Gründung einer Stiftung in der Schweiz sollten Stifter:innen einmalige und wiederkehrende Kosten berücksichtigen. Diese hängen vom Umfang und der Komplexität der Stiftung ab. In der Regel wird mit einmaligen Ausgaben von CHF 10’000 bis 15’000 gerechnet. Darin enthalten sind Anwalts- und Notariatskosten, Gebühren für den Handelsregistereintrag und die Abwicklung der Stiftungsaufsicht. Die Kosten können allerdings je nach Kanton und Komplexität variieren.
Dazu kommen die laufenden Kosten: Buchhaltung, Jahresrechnung, Revisionspflichten, Verwaltung und, je nach Struktur der Stiftung, der Betrieb einer Geschäftsstelle. Stiftungen, die vollständig ehrenamtlich geführt werden, kommen günstiger weg. Doch bei wachsender Fördertätigkeit ist eine professionelle Struktur meist unverzichtbar.
Der richtige Zeitpunkt: Stiftung gründen zu Lebzeiten oder per Testament?
Eine Stiftung kann entweder zu Lebzeiten oder im Todesfall – also durch ein Testament oder einen Erbvertrag – gegründet werden. In der Praxis bevorzugen viele Stifter:innen eine Mischform: Bereits zu Lebzeiten wird die Stiftung mit einem kleinen Anfangskapital errichtet und nach dem Tod weiter aufgefüllt. Dies erlaubt Stifter:innen, die Stiftung aktiv mitzugestalten. Und ihr Wille wird auch nach ihrem Tod umgesetzt.
Stiftungsorgane: Wer übernimmt Verantwortung?
Obwohl eine Stiftung als eigenständige juristische Person gilt, die unabhängig von dem:der Stifter:in agiert, ist sie selbst nicht handlungsfähig. Daher braucht es in jeder gemeinnützigen Stiftung funktionierende Organe.
Im Zentrum steht der Stiftungsrat, bestehend aus meist drei bis fünf Personen. Mindestens ein Mitglied muss in der Schweiz wohnhaft sein. Der Stiftungsrat trägt die strategische Verantwortung und sorgt dafür, dass der Zweck im Sinne des:der Stifter:in erfüllt wird. Die Stiftungsrät:innen arbeiten häufig ehrenamtlich, sie können aber auch entlöhnt werden.
Unterstützt wird der Stiftungsrat oft durch eine Geschäftsstelle, insbesondere bei operativen Stiftungen mit eigener Projektarbeit. Die Geschäftsstelle ist zuständig für die Umsetzung der Förderstrategie, die Kommunikation, Administration und den Kontakt mit den Destinatären – also den Begünstigten.
Jede Stiftung untersteht zudem der Stiftungsaufsicht. Diese prüft regelmässig, ob die Stiftung ihren Zweck korrekt umsetzt. Je nach geografischer Ausrichtung ist entweder die kantonale oder die eidgenössische Aufsichtsbehörde zuständig.
Der Gründungsprozess in vier Phasen
Die Gründung einer Stiftung verläuft in mehreren Etappen, die aufeinander aufbauen. Eine klare Übersicht der Gründungsphasen erleichtert den Ablauf und sorgt dafür, dass die Stiftung von Beginn an rechtlich, organisatorisch und finanziell solide aufgestellt ist.
1. Zweck und Planung
Als erstes müssen Stifter:innen ihre Vision konkretisieren und alle Eckpfeiler definieren: Was ist das Ziel der Stiftung? Wie kann es erreicht werden? Welche Mittel stehen zur Verfügung? Wann soll die Stiftung gegründet werden?
2. Rechtliche Vorbereitung
Im zweiten Schritt werden die Stiftungsurkunde und das Reglement ausgearbeitet. Sie enthalten unter anderem Zweck, Vermögen, Sitz und Zusammensetzung des Stiftungsrats.
3. Offizielle Gründung
Der eigentliche Gründungsakt erfolgt durch eine öffentliche Urkunde beim Notariat – alternativ durch Testament oder Erbvertrag. Anschliessend wird die Stiftung im Handelsregister eingetragen und erhält damit ihre Rechtsfähigkeit. Auch die Stiftungsaufsicht und die Steuerbehörden werden in diesem Schritt einbezogen.
4. Verwaltung und Betrieb
Nach der Gründung beginnt der operative Betrieb: Buchhaltung, Berichterstattung, Projektförderung, Kommunikation. Wer professionell arbeiten möchte, sollte sich frühzeitig Gedanken über die passende Struktur und über digitale Tools zur Stiftungsverwaltung machen.
Vor- und Nachteile einer eigenen Stiftung in der Schweiz
Eine gemeinnützige Stiftung bietet viele Möglichkeiten. Gleichzeitig darf der Aufwand nicht unterschätzt werden. Stifter:innen sollten sich vor der Gründung einer gemeinnützigen Stiftung in der Schweiz mit den Chancen und Herausforderungen auseinandersetzen:
Vorteile
• Steuerbefreiung durch Gemeinnützigkeit
• Langfristige Wirksamkeit über die eigene Lebenszeit hinaus
• Juristische Selbstständigkeit und Unabhängigkeit
• Klar geregelte Nachlassplanung
Nachteile
• Hohe Initialkosten und laufender administrativer Aufwand
• Dauerhafte Zweckbindung des Vermögens
• Strenge rechtliche Rahmenbedingungen
Von Anfang an richtig gründen
Wer eine Stiftung gründen will, findet in der Schweiz rechtlich wie auch steuerlich gute Voraussetzungen. Trotzdem gilt: Ohne solide Planung wird das Potenzial einer Stiftung selten voll ausgeschöpft. Als grösste Stiftungsplattform der Schweiz unterstützt Sie StiftungSchweiz mit digitalen Tools, damit Ihre Vision zur wirksamen und langfristigen Realität wird.